Vorworte
Heimkehr gibt es nicht
Über Bücher, die kommen. Von Angela Schader
23.05.2024. Oft wird Ling Ma auf ihren Migrationshintergrund angesprochen, und diese "Bürde der Repräsentation" trägt die chinesisch-amerikanische Autorin eher unwillig. Nach ihrem Debütroman, der schon 2018 ein sinistres Pandemie-Szenario entwarf, legt Ma nun eine Erzählsammlung vor. Auch die Frage der Herkunft scheint darin auf - und wird den Lesern in überraschenden, gelegentlich skurrilen Szenarien wieder zuspielt.
Doch. "Severance" hieß der zwei Jahre zuvor publizierte Pandemie-Roman, mit dem sich die chinesisch-amerikanische Schriftstellerin Ling Ma der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Der wache deutsche Verlag CulturBooks griff zu, im März 2021 lag die von der Co-Leiterin Zoë Beck besorgte Übersetzung vor. Sie hat nun auch Ling Mas zweites Buch ins Deutsche übertragen: "Glückscollage" heißt die Erzählsammlung, die im Original 2022 unter dem Titel "Bliss Montage" erschienen ist - und über deren effektiven Glücksgehalt sich trefflich streiten lässt.
Glück liegt natürlich auch aufseiten und im Auge des Betrachters. Ginge man nicht angeregter, beschwingter durch den Tag, wenn einem unterwegs etwa ein hübscher Lippenstiftmund, darüber ein Paar sorgsam geschminkte Augenlider entgegengeschwebt kämen - nur gerade das, ohne den Ballast einer Trägerin aus Fleisch und Blut? Ja, ein Glücksmoment wär's, allerdings nicht für besagte Trägerin; denn die wollte eigentlich ganz unsichtbar durch die Straßen schweifen. In Ling Mas Story "G" ist dies durch Einnahme der titelgebenden Droge zu bewerkstelligen, allerdings muss man sich zuvor nicht nur von Kleidung und Schmuck befreien, sondern auch das Make-Up bis auf den letzten Hauch entfernen.
Das tönt nun doch etwas überspannt. Aber was sagt die Schriftstellerin dazu? "Ich hatte das Gefühl, die Stories könnten so realistisch oder so befremdlich sein, wie sie wollten, aber ich müsse dabei die Taschenspielerei auch transzendieren", erklärt sie im Interview mit dem Online-Magazin The Cut. Und das werde möglich, wenn die Geschichten auf der emotionalen Ebene "im Realismus verankert und verwurzelt" seien. "G" ist ein Paradebeispiel, wie Ling Ma dies angeht - und dabei den Blick auf Frauenbeziehungen, insbesondere im Kontext ihres eigenen soziokulturellen Umfelds, erschreckend scharf stellt.
Den Namen der Ich-Erzählerin, Bea, erfahren wir erst fast am Schluss der Story. Eine winzige, subtile Geste ist das, quasi ein letzter Versuch, diese junge Frau kurz vor ihrem endgültigen Verschwinden doch noch festzuhalten. Bea hat sich über Jahre an G so reichlich bedient, dass sich, wie sie einmal sagt, ihr Selbstgefühl in der totalen Absenz ihres Spiegelbilds entwickelt habe: "Für jemanden wie mich ist das eine gewisse Form der Freiheit." Ist sie denn dermaßen hässlich? Davon steht nichts zu lesen. Vielmehr versuchte sie sich den steten Pressionen der Mutter zu entziehen, die sie nach ihrem eigenen, perfekten Bild modellieren wollte.
Dabei liegt das Grundthema der Erzählung tiefer als im äußeren Schein. Dass asiatische Immigrantinnen und Immigranten auch in Amerika den in ihren Herkunftsländern herrschenden Leistungsdruck nicht abschütteln können, ihn vielleicht sogar doppelt verspüren, spricht Ling Ma in ihren literarischen Texten wie in Interviews immer wieder einmal an; in "G" wollte sie den Figuren dieses Leben im permanenten Wettbewerb sozusagen direkt auf den Körper schreiben. So spielt es auch in Beas Freundschaft mit der gleichaltrigen, ebenfalls chinesischstämmigen Bonnie hinein, die, kaum hat Bea die krittelnde Mutter einigermaßen ausgeschaltet, deren Rolle übernimmt. Noch die Umarmung, mit der sich die Mädchen begrüßen, entspricht der Taktik chinesischer Tiger-Moms, indem dabei nebenher der Körper der Anderen abgetastet und auf zusätzliche oder geschwundene Pfunde hin geprüft wird. Doch die Beziehung der beiden ist komplexer, denn sie haben sonst keine Freundinnen aus der gemeinsamen Herkunftswelt. Daraus entsteht eine gelegentlich ins Erotische spielende Nähe, wobei nun Bonnie die Rolle der Werbenden übernimmt - und die Protagonistin damit auf Messers Schneide setzt. Einerseits bangt ihr davor, dass Bonnie sie irgendwann vollständig aufzehren werde: "Ich würde in ihrem Verdauungstrakt enden, während sie meine besten Seiten verstoffwechselte und den Rest ausschied." Andererseits ist die Freundin die Einzige, die Bea aus der selbstgewählten Unsichtbarkeit zu befreien vermag: "Von ihr erblickt, lernte ich, ich selbst zu werden. Ihr Interesse verwirklichte mich." Wohin dieser Kantengang führt, sei nicht verraten, aber eine jedenfalls absolviert ihn brillant: Ling Ma selbst.
Sonderlich wohl fühlt sich die Schriftstellerin allerdings nicht mit den Erwartungen, die fast reflexhaft an Literaturschaffende mit Migrationshintergrund herangetragen werden. Von der "Bürde der Repräsentation" spricht sie im Podcast "American Masters: Creative Spark" und erklärt, wie man als aus einer Minderheit stammende Autorin beim Schreiben laufend kalibrieren müsse: "Was sagt das über die ganze Gemeinschaft? Kann es einfach als eine Geschichte für sich dastehen, als etwas Eigenes, Spezifisches, ohne gleich eine ganze Gruppe repräsentieren zu müssen?" Dementsprechend ist die Thematik der Herkunft längst nicht in allen in "Glückscollage" versammelten Stories präsent, und dort, wo sie aufscheint, wird sie auf unterschiedlichsten Ebenen angesprochen.
So inszeniert "Rückkehr" das Verhältnis zum Herkunftsland nicht nur in der Rahmenhandlung, wo eine in den Anfängen ihrer Karriere steckengebliebene Autorin ihren ebenfalls schreibenden Ehemann erstmals auf einer Reise in seine Heimat begleitet, sondern variiert es auf einer in die Erzählung eingelassenen literarischen Ebene. Die beiden Hauptfiguren haben das Motiv der (scheiternden) Heimkehr in Romanen behandelt, die kurz referiert werden, ein Freund der Protagonistin hat es in eine Graphic Novel umgesetzt. Aber auch die auf der Realitätsebene einsetzende Ferienreise des Ehepaars hebt ab in ein zunehmend surreal-albtraumhaftes Szenario.
Tatsächlich, so erfährt man aus Ling Mas Gespräch mit "The Cut", war diese Story durch einen Traum inspiriert, und dasselbe gilt für "Morgen". Dort entdeckt Eve, die schwangere Protagonistin, plötzlich ein fleischiges Anhängsel, das aus ihrer Vagina ragt und sich bei näherer Betrachtung als Ärmchen des Babys entpuppt. Dieses Motiv ist ebenfalls direkt aus einem Traum übernommen, im Text freilich wird der Zustand auf Dauer gestellt. Das unbotmäßige Glied wächst und gedeiht, ist obendrein auch zu Willensäußerungen fähig: Als Eve eines Nachts am Strand von Miami steht, regt sich das Ärmchen und weist unmissverständlich auf den Ozean hinaus. "Okay, wir werden gehen", verspricht Eve, und am Ziel der Reise findet die Geschichte ihr eigentliches Gravitationszentrum. Es ist Eves in einem andeutungsweise als China kenntlich gemachten Land gelegene Heimatstadt, anhand deren Ling Ma die Verklammerung von Abhängigkeit und Abwehr inszeniert, die auf kultureller wie wirtschaftlicher Ebene oft die Beziehung zwischen asiatischen und westlichen Ländern prägt.
Amerika hat in "Morgen" seine Vorrangstellung verloren, ist keine Wirtschaftsmacht mehr und kein angesagtes Ziel für Migranten; stattdessen landet Plastikmüll an seinen Stränden, die historischen und kulturellen Schätze des Landes werden als Leihgaben von sekundärer Bedeutung in ausländischen Museen präsentiert. Im Herkunftsland der Protagonistin aber prägen trotz einer Entamerikanisierungs-Kampagne nach wie vor westliche Bauformen und amerikanischer Lifestyle das Stadtbild: Das Haus, wo Eve unterkommt, erinnert äußerlich an New Yorker Vorkriegsarchitektur, innen präsentiert sich ein Mischmasch europäischer Stilelemente. In der Stadt entdeckt sie Supermärkte und Reklametafeln nach amerikanischem Muster oder vertraut anmutende Fast-Food-Lokale mit bloß leicht veränderten Namen, und zieht eine denkbar dürre Bilanz: "Eine Ideologie, die sich einzig darüber definiert, was sie ablehnt, ist dazu verdammt, genau darüber definiert zu werden. Es gab zwar keine KFCs mehr, aber die CFCs sahen ziemlich ähnlich aus."
In einer Story allerdings, in "Pekingente", geht Ling Ma den Themenkomplex Migration und Literatur scheinbar ganz realitätsnah an - und richtet dabei eine leise Warnung an die Leserschaft, auch solch vermeintliche Unmittelbarkeit achtsam zu genießen. Hinterlegt wird dies gleich zu Beginn mit dem Verweis auf die titelgebende Geschichte, die realiter von China nach Amerika wanderte und dabei mehrfach gebrochen wurde. Die aufwendig zubereitete Ente gekostet und schwärmerisch davon erzählt hat eine aus eher bescheidenen Verhältnissen stammende Frau in China. Deren Mann referierte das Erlebnis dann in einem Englischkurs als den glücklichsten Moment in seinem eigenen Leben; der Kursleiter Mark Salzman wiederum packte die Episode in seinen 1986 erschienenen autobiografischen Roman "Iron and Silk". Dort hat sie die amerikanische Autorin Lydia Davis aufgegriffen und zu "Happiest Moment", einer ihrer virtuosen Prosaminiaturen, kondensiert. Wem nun gehört die Geschichte? Darf Davis Autorenrechte einfordern, könnte Salzman ihr diese streitig machen, und wo, bitte, bleibt die (vermutlich längst verstorbene) eigentliche Urheberin?
Einer solchen Frage muss sich dann auch die Hauptfigur von "Pekingente" stellen, eine junge chinesisch-amerikanische Schriftstellerin, deren Kindheit maßgeblich von der starken, autoritären Mutter geprägt wurde. Stärke hieß dabei primär, jedes Leid und jede erfahrene Kränkung standhaft zu verleugnen: So wollte die Mutter vom Mobbing in der Schule nichts hören und legte dem Kind stattdessen mit Suggestivfragen wie "Du hast viele Freundinnen, richtig?" gleich die gewünschte Antwort in den Mund. "Sie wollte in diesen Lügen baden", heißt es - aber nur in jenen, die in ihre Optik passten. Denn später, als die Tochter in ihrem ersten Buch die Erinnerung an ein beklemmendes, von Rassismus und latenter Gewalt unterlegtes Erlebnis der Mutter literarisch umsetzt, geht's plötzlich um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit: Die Mutter spricht ihr das Recht, die Geschichte zu erzählen, rundweg ab, diese sei schließlich ihr widerfahren und nicht "uns".
Was an jenem Tag geschehen war, erfährt man im letzten Teil der Story. Aber wer hier erzählt, ob die Tochter oder die Mutter selbst - das bleibt die Frage, der sich die Leserin zu stellen hat.
Interessant im Blick auf Ling Mas Umgang mit realistischen und surrealistischen Erzählmodi sind "Los Angeles" und "Orangen", die beiden ersten Texte in "Glückscollage". Beide kreisen um dieselbe Gewalterfahrung: die Ich-Erzählerin wird nachts von ihrem Partner Adam brutal misshandelt. "Orangen" inszeniert das Thema gewissermaßen auf dem harten Straßenpflaster der Realität, wo die Protagonistin, längst von Adam getrennt, eines Abends ihren einstigen Peiniger bis zu seinem neuen Wohnort verfolgt. Der Text entwickelt nicht nur ein mit ungewöhnlichen Schattierungen versehenes Charakterbild des Gewalttäters, sondern auch die tiefe Ambivalenz, die das Verhältnis der Frau zu ihm prägt - denn noch Jahre nach dem brutalen Übergriff kommt sie innerlich nicht von ihm los. "Los Angeles" dagegen nimmt uns mit auf einen skurrilen literarischen Husarenritt, wo die Heldin in den Hügeln über der kalifornischen Metropole residiert, als Gattin eines Mannes, der so üppig verdient, dass er in Dollarzeichen spricht und in Cent-Symbolen weint. Im rückwärtigen Flügel der Villa sind ihre hundert Ex-Liebhaber untergebracht - darunter auch Adam -, von denen sie sich einstweilen nicht trennen mag; bei gemeinsamen Vergnügungstouren in der Stadt vermögen sich die Herren wundersamerweise allesamt in den Porsche der Protagonistin zu quetschen. Adam bestreitet dann zwar das Finale der Story, aber die denkwürdigste Figur bleibt wohl doch der weidlich ausgenutzte Ehemann. Wer hätte gedacht, wie expressiv sich schnöde Währungssymbole einsetzen lassen? Und als der arme Kerl - "$$ $$$$ $$$$$$$$$??!!" - für einmal Tacheles redet, wird die Reaktion der Protagonistin herrlich doppelschneidig ausgedrückt: "Wenn einen die Wahrheit schließlich trifft, klingt es ziemlich genau wie der Jackpot beim Glücksspielautomaten."
Auch Ling Mas Pandemie-Roman war ursprünglich als Short Story angelegt. Mit einer "dumpfen, destruktiven Wonne" habe sie "Severance" angepackt, gesteht sie Alissa Songsiridej im digitalen Magazin Electric Literature - und zwar im Büro, während der Arbeitszeit. Die Firma, in der sie damals tätig war, rationalisierte gerade im großen Stil Leute weg, Angst, Wut und Frustration trieben die Belegschaft um, Ma wusste, dass auch sie bald ihren Posten verlieren würde. Dabei trat ein älteres, tiefer sitzendes Unbehagen an die Oberfläche, dem sie literarische Gestalt geben wollte. Denn nicht nur sie, sondern auch alle ihre Freunde hätten es nach dem Abschluss des Colleges verspürt: "dieses Gefühl von Unzufriedenheit, beinah schon Resignation, das einen überkommt, wenn man einem kapitalistischen System zuarbeitet, das man letztlich nicht verändern kann."
So lässt sie Candace Chen, ihre Hauptfigur, bei einem Unternehmen arbeiten, wo sie für amerikanische Verleger möglichst preisgünstige Verträge mit chinesischen Druckereien und anderen fernöstlichen Produktionsbetrieben aushandeln muss; ein reiner Verdienstjob, an dem ihr nichts liegt und dessen ausbeuterische Dimension sich nicht ausblenden lässt. Aber warum - so die nächste Frage, die sich der Autorin stellte - gibt Candace dabei dennoch verbissen ihr Bestes? Da sei sie, sagt Ma, einmal mehr bei der soziokulturellen Prägung angekommen, dem "sehr spezifischen Erfolgsdruck, der auf den Kindern asiatischer Immigranten lastet". Spätestens zu diesem Zeitpunkt gewahrte die Autorin, dass der Stoff die Dimensionen einer Short Story sprengen würde: So schaltet sie in die Haupterzählung auch Rückblenden ein, welche die Familiengeschichte der Protagonistin rapportieren. Candace bleibt zunächst in der Obhut der Großeltern in China zurück, als ihre Eltern in die USA emigrieren. Zwei Jahre später wird das Kind nachgeholt - und findet die Mutter völlig verändert: "In diesem neuen Land war sie streng, diszipliniert, restriktiv, anfällig für Wutausbrüche, schnell frustriert, sehr faschistisch mit willkürlichen Regeln, die selbst mir als Sechsjähriger unvernünftig vorkamen."
Aus China kommt dann auch das tödliche Shen-Fieber, das dem Romangeschehen die Bühne bereitet; und Ling Ma zieht eine direkte Parallele zwischen der Migrationserfahrung und apokalyptischen Narrativen wie dem Pandemie-Szenario. "Beide sind traditionsgemäß durch ein Davor und ein Danach organisiert", erklärt sie im Gespräch mit Alissa Songsiridej. "Da ist dieser Bruch in der Zeit, der auch zu einem Bruch im Selbst führt. Wenn man ein multiples Selbst und eine multiple Zeitachse hat, wie soll man sich dann eine Zukunft vorstellen können?"
Den Grundrhythmus von "New York Ghost" - so der Titel der deutschen Ausgabe von "Severance" - bestimmt primär der Wechsel zwischen Kapiteln, die Candaces Leben in New York vor und während der Pandemie nachzeichnen, und solchen, die nach ihrer Flucht aus der zur Geisterstadt gewordenen Metropole handeln. Irgendwo im ebenfalls entvölkerten Umland strandet die Protagonistin und wird von ein paar anderen Überlebenden aufgelesen. Sie alle sehen sich mit dem von Ma skizzierten Existenzbruch konfrontiert: Eben noch in einem modernen, urbanen Arbeitsleben und Lifestyle aufgehoben, sind sie nun, da das Internet kollabiert ist und Google keinen Rat mehr weiß, weitgehend hilflos. Auch die Hoffnung, gemeinsam einen Neustart wagen und diesmal alles besser machen zu können, droht bald abzusacken - nur einer in der Gruppe fängt sie auf: der charismatische, autoritäre Bob, der seine Sicherheit aus dem Glauben und sein überlebenstechnisches Knowhow aus langjähriger Warcraft-Praxis schöpft. Teils folgsam, teils unwillig beugen sich die acht anderen Mitglieder seinem rigiden, messianisch aufgeladenen Führungsstil. So dankt man Gott gemeinsam für den anstehenden Segen, bevor man auf die "Pirsch" geht: So nennt Bob die perfekt durchorganisierten Raubzüge in Shopping Malls und Wohnhäusern, bei denen alles behändigt wird, was zum Überleben nötig und für die gemeinsame Zukunft tauglich scheint. Und bei denen gelegentlich Blut fließt.
Denn noch sind nicht alle Menschen tot, die das Shen-Fieber gepackt hat. Und so gewinnt das Krankheitsbild der Pandemie, zunächst beharrlich totgeschwiegen, allmählich Kontur: Wir erfahren, dass die Befallenen "alte Routinen und Gesten, die ihnen schon seit Jahren, Jahrzehnten zu eigen waren", endlos repetieren und dabei früher oder später zugrunde gehen. Wie das ausschaut zeigt sich, als die Gruppe in ein Haus eindringt, wo eine vom Fieber bereits schwer gezeichnete Familie vegetiert. Vor der Plünderung treibt man die Kranken im Esszimmer zusammen, wo sie augenblicklich in eine Endlosschlaufe von Aufdecken, Schöpfen und Essen, Abräumen und wieder Aufdecken verfallen - wobei die Schüsseln und Teller von A bis Z leer bleiben. Am Ende der Pirsch werden die Opfer gemäß Bobs euphemistisch verbrämtem Prozedere mithilfe von Schusswaffen "erlöst".
Das Shen-Fieber halte die Opfer "für immer in ihren Erinnerungen gefangen", überlegt Candace einmal, und diese Wahrnehmung der Krankheit deckt sich mit ihrem eigenen, sinistren Blick auf die Vergangenheit: Sie sei "ein schwarzes Loch, das wie eine Wunde in die Gegenwart gebohrt wurde, und wenn man ihm zu nahe kommt, wird man hineingezogen". Aber mit dieser Interpretation des Shen-Fiebers konkurriert, dem Text unterschwellig eingeschrieben, eine andere - und die schließt das Krankheitsbild direkt mit realen Arbeitsverhältnissen kurz. Denn quer durch den Roman klingt in den Rückblenden auf die Jahre, die Candace im Dienst des Unternehmens verbracht hat, immer wieder ein Refrain kurzer Sätze auf: "Ich stand auf. Ich ging morgens zur Arbeit. Ich ging abends nach Hause. Ich wiederholte die Routine."
Die Pandemie, so wie wir sie von vier Jahren erlebten, hat die meisten von uns praktisch von einem Tag aus dem andern aus solchen Routinen katapultiert. Dieser Existenzbruch ist nun ausgestanden. Gut möglich aber, dass sich auf den Fersen von Covid 19 die real existierende Variante des Shen-Fiebers still und leise wieder eingeschlichen hat.
 Ling Ma: Glückscollage
Ling Ma: Glückscollage Storys.
Aus dem Englischen von Zoë Beck.
CulturBooks, Hamburg 2024. 216 Seiten, gebunden, 23 Euro.
Erscheint am 3. Juni 2024
Zur Leseprobe
(bestellen bei eichendorff21)
Mehr Infos beim Verlag CulturBooks
Kommentieren








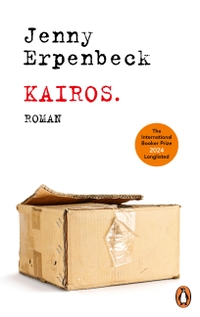 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung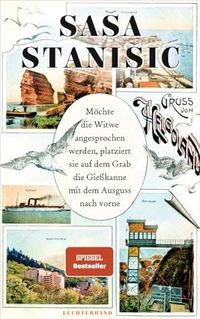 Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne
Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne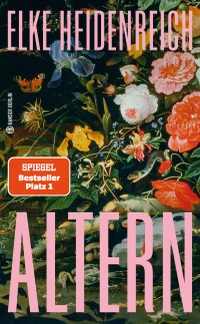 Elke Heidenreich: Altern
Elke Heidenreich: Altern